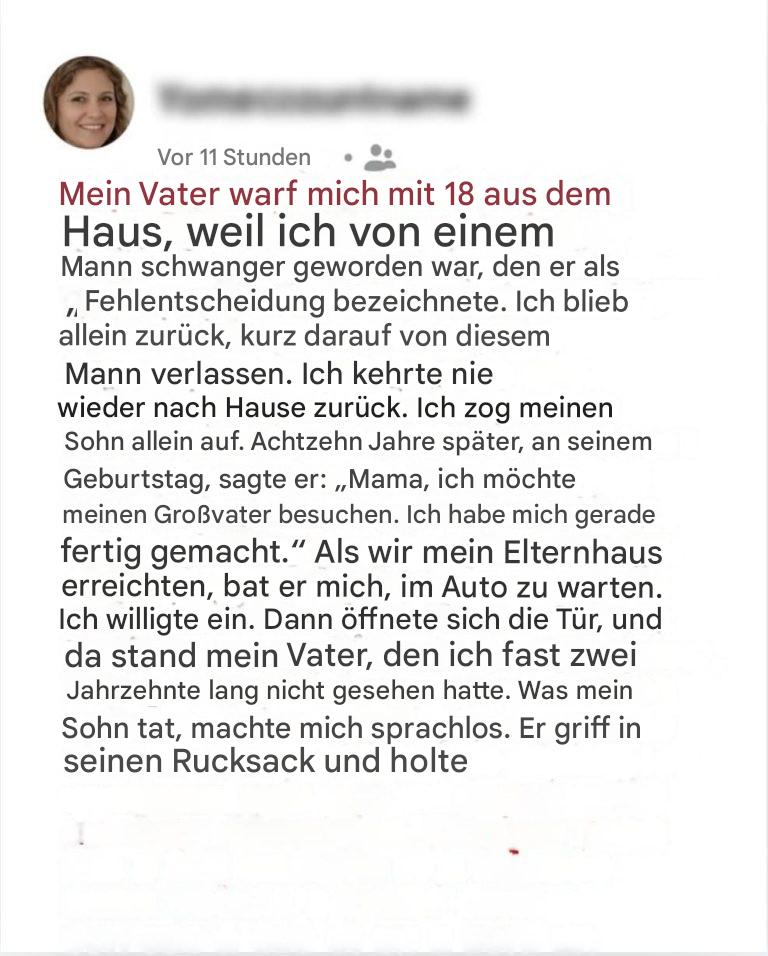
Mein Vater warf mich aus dem Haus, als er herausfand, dass ich schwanger war – 18 Jahre später besuchte ihn mein Sohn
„Sein Name ist Tyler. Er ist in meiner Klasse. Er … kommt nicht aus wohlhabenden Verhältnissen. Seine Familie hat Probleme, aber er sagte, er würde alles tun, um dabei zu sein.“
Ein Moment der Stille.
„Werden Sie das Baby behalten?“, fragte er.
“Nicht”.

Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück und atmete langsam durch die Nase aus. „Überlegen Sie sich gut, was Sie jetzt sagen.“
„Ja, ich behalte es“, antwortete ich. „Und ich werde meine Meinung nicht ändern.“
Er sah mich mit zusammengebissenen Zähnen an, als könnte er mich dazu bringen, alles in Frage zu stellen. Als das nicht funktionierte, veränderte sich sein Gesichtsausdruck – nicht in Wut, sondern in etwas Schlimmeres: Verachtung.
„Du bist siebzehn“, sagte er leise. „Und du beschließt, dein Leben für einen armen Jungen wegzuwerfen, der kaum für sich selbst sorgen kann?“
„Ich werfe nichts weg“, sagte ich ruhig, aber bestimmt. „Ich kann es schaffen. Ich werde es tun.“

Er schob seinen Stuhl zurück und stand auf. Er ging zur Haustür und öffnete sie.
„Du willst ein uneheliches Kind mit einem armen Jungen großziehen?“, murmelte er und blickte auf die Straße hinter der Veranda. „Dann mach es selbst.“
Das war’s. Kein Geschrei. Keine Fragen. Nur ein Satz, der alles beendete.
Ich war siebzehn Jahre alt und plötzlich war ich obdachlos.

Mein Vater – ein bekannter Geschäftsmann, der eine florierende Kette von Autowerkstätten besaß – schenkte mir nie die geringste Beachtung.
Kein einziger Anruf. Kein Cent. Ich glaube nicht, dass er jemals nach mir gesucht hat.
Ich habe sein Bett gemacht. Und er ließ mich einfach darin liegen, egal wie kalt oder kaputt es war.
Auch der Vater meines Kindes hielt nicht lange durch. Zwei Wochen nachdem er das Haus meines Vaters verlassen hatte, ging er nicht mehr ans Telefon. Er machte Versprechungen, sagte, er würde mich unterstützen und alles tun, was nötig sei. Aber mit Versprechungen lassen sich keine Windeln bezahlen. Oder Miete. Oder Krankenhausrechnungen.

Ein Moment der Stille.
„Werden Sie das Baby behalten?“, fragte er.
“Nicht”.

Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück und atmete langsam durch die Nase aus. „Überlegen Sie sich gut, was Sie jetzt sagen.“
„Ja, ich behalte es“, antwortete ich. „Und ich werde meine Meinung nicht ändern.“
Er sah mich mit zusammengebissenen Zähnen an, als könnte er mich dazu bringen, alles in Frage zu stellen. Als das nicht funktionierte, veränderte sich sein Gesichtsausdruck – nicht in Wut, sondern in etwas Schlimmeres: Verachtung.
„Du bist siebzehn“, sagte er leise. „Und du beschließt, dein Leben für einen armen Jungen wegzuwerfen, der kaum für sich selbst sorgen kann?“
„Ich werfe nichts weg“, sagte ich ruhig, aber bestimmt. „Ich kann es schaffen. Ich werde es tun.“

Er schob seinen Stuhl zurück und stand auf. Er ging zur Haustür und öffnete sie.
„Du willst ein uneheliches Kind mit einem armen Jungen großziehen?“, murmelte er und blickte auf die Straße hinter der Veranda. „Dann mach es selbst.“
Das war’s. Kein Geschrei. Keine Fragen. Nur ein Satz, der alles beendete.
Ich war siebzehn Jahre alt und plötzlich war ich obdachlos.

Mein Vater – ein bekannter Geschäftsmann, der eine florierende Kette von Autowerkstätten besaß – schenkte mir nie die geringste Beachtung.
Kein einziger Anruf. Kein Cent. Ich glaube nicht, dass er jemals nach mir gesucht hat.
Ich habe sein Bett gemacht. Und er ließ mich einfach darin liegen, egal wie kalt oder kaputt es war.
Auch der Vater meines Kindes hielt nicht lange durch. Zwei Wochen nachdem er das Haus meines Vaters verlassen hatte, ging er nicht mehr ans Telefon. Er machte Versprechungen, sagte, er würde mich unterstützen und alles tun, was nötig sei. Aber mit Versprechungen lassen sich keine Windeln bezahlen. Oder Miete. Oder Krankenhausrechnungen.
